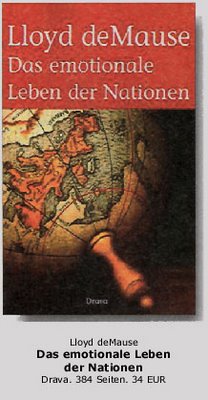[…] Dabei ist die Freundin, ähnlich wie der Kurschatten, zunächst nur ein Selbsthilfeversuch und eine taktische Möglichkeit im Ehekrieg. Merkwürdiger- und bezeichnenderweise sorgt nämlich derjenige, der fremd geht, unbewußt dafür, daß der Partner das erfährt: Durch einen Brief, ein Bild oder eine Telefonnummer, die man »versehentlich« in der Tasche oder sonstwo liegen läßt, durch angeblich anonyme Telefonanrufe, merkwürdige Zeitplanungen, phantasiereiche aber durchsichtige Alibis … Neue oder außereheliche Partnerschaften sind einerseits der Versuch, die eigenen Schwierigkeiten mit einem anderen Partner zu lösen, gleichzeitig aber auch eine sehr indirekte und mißverständliche Liebeserklärung an den »alten« Partner (»Kümmere dich mehr um mich! So geht es nicht weiter!«). Sie sind aber oft nur eine Wiederholung der alten Schwierigkeiten, eine unveränderte Neuauflage, »mehr Desselben« (nach Watzlawick). So wie es eine Patientin ausdrückte, nachdem sie während einer stationären Psychotherapie ihre vierte Scheidung hinter sich gebracht hatte: »Merkwürdig - es waren immer die gleichen Typen!« Am Anfang der Partnerschaft gab es noch Unterschiede zwischen den vier Partnern, am Ende der Beziehung, wenn sie mit ihren Männern vor dem Scheidungsrichter stand, waren sie gleich geworden. Jeder schafft sich eben immer wieder mit den verfügbaren Partnern und Möglichkeiten seine eigene Welt!
Geheime Schwierigkeiten und Hoffnungen
Die Schwierigkeiten in der Partnerschaft liegen oft nicht am Partner, sondern tiefer, sozusagen in einer gemeinsamen Tiefe. Der Züricher Paartherapeut Jürg Willi hat in seinen Büchern über die Zweierbeziehung Partnerschaften als Kollusionen beschrieben (nach lat. colludere: spielen mit …, unter einer Decke stecken mit …), als ein geheimes Zusammenspiel zur Lösung eines gemeinsamen unbewußten Grundkonfliktes. Das bedeutet, daß beide Partner, beide Eheleute eine gemeinsame Schwierigkeit haben, die ihnen aber unbewußt ist. Bei Adam und Eva ging es um die gemeinsame Aufgabe, ganz Mensch in der Zweisamkeit zu werden. Bei der Kollusion, dem geheimen Zusammenspiel, übernimmt und lebt einer der Partner die aktive Rolle, der andere die passive. Das erklärt auch, warum der Volksmund meint: »Gleich und Gleich gesellt sich gern« und »Gegensätze ziehen sich an!« Gleich ist in der Partnerschaft der Grundkonflikt, gegensätzlich sind die gelebten Lösungsmöglichkeiten. Dabei kann – wie bei Adam und Eva – die vermeintlich schwache Frau insgeheim die Führung übernehmen, und der vermeintlich starke Mann ist vorwiegend das, was seine Frau aus ihm macht (Ich weiß, wovon ich rede!). Diese nach vorwärts oder rückwärts gerichteten Selbstheilungsversuche scheitern schließlich doch durch die Wiederkehr und die Dennochdurchsetzung des Verdrängten. Partnerschaftliche Schwierigkeiten können dann zu psychosomatischen Symptomen und Erkrankungen führen oder zu schwerwiegendem »krankhaften« Verhalten.
Partner sind bedarfsgerecht
Im Rahmen der Neurosenlehre hat man sogar von »neurotischer Partnerwahl« gesprochen. Dabei ist das vermeintlich Neurotische etwas zutiefst Menschliches. Jeder Partner sucht sich seine Ergänzung, sucht seine (bessere) Hälfte. Von der Neurosenlehre her gesehen bedeutet das, daß z. B. vorwiegend schizoid Strukturierte von vorwiegend depressiv Strukturierten angezogen werden und umgekehrt. Denn jeder hat das, was dem anderen fehlt. Der kühle zurückhaltende Schizoide sucht die Wärme und Gebefreudigkeit des Depressiven, der überanstrengte Depressive sucht die Abgrenzungsfähigkeit und Sicherheit des Schizoiden. Ähnlich ist es bei Partnerschaften zwischen vorwiegend zwanghaft Strukturierten und vorwiegend hysterisch Strukturierten. Der Zwanghafte soll in das Chaos des hysterischen Partners mehr Ordnung bringen, der hysterische Partner soll mehr Leben und Farbe in die im Ordnungssinn erstarrte Welt des Zwanghaften bringen. Andererseits ist die Partnerin, der Partner im narzißtischen Bereich (im Bereich der eigenen Großartigkeit) eine lebensnotwendige Aufwertung. Der von seiner Großartigkeit überzeugte Narzißt heiratet den ihn bewundernden Komplementär-Narzißten, also seine eigene Fan-Gemeinde, die die schmerzliche Lücke im Selbst füllt. Wenn dieser im Grunde gesichtslose Lückenfüller eigene Bedürfnisse entwickelt, wird er für den Narzißten unbrauchbar.
An diesen Beispielen wird deutlich, daß es in der Partnerschaft um gegenläufige Wünsche geht, deren gleichzeitige Erfüllung unmöglich ist. So gesehen ist jede Partnerschaft ein Selbsthilfeversuch. Gelingt er, dann nennt man das eine glückliche Ehe, gelingt er nicht, dann wird daraus ein manchmal behandlungsbedürftiger Partnerkonflikt. In der Behandlung dieser Partnerkonflikte wird dann oft deutlich, daß es gleichzeitig geheime und geheimste Zusätze zum Ehevertrag gibt, die sich gegenseitig ausschließen und zu allem Unglück auch noch unbewußt sind. Es kann also nicht darüber gesprochen werden, aber jeder besteht auf der Erfüllung seiner unbewußten und (damit) unerfüllbaren Forderungen.
Geheime und streng geheime Zusätze zum Ehevertrag
Die geheimen Forderungen, die geheimen Zusätze zum Ehevertrag haben etwa folgenden Wortlaut: »Ich will Dich als Partner oder Ehepartner, weil du … und damit du…«. Die streng geheimen Zusätze lauten dann: »Ich mache Dir die Erfüllung meiner Forderungen so schwer wie möglich oder sogar unmöglich, weil ich Angst vor dieser neuen Erfahrung habe.« Bei Adam könnte der geheime Zusatz in etwa so gelautet haben: »Ich will Dich als meine Partnerin, weil du ein Geschenk des Himmels bist und damit du mir im Paradies den Himmel auf Erden bereitest.« Der streng geheime Zusatz wäre dann gewesen: »Ich werde Dir dabei überhaupt nicht helfen. Wenn Du mich brauchst, bin ich nicht da. Wenn es schwierig wird, sage ich kein Wort. Wenn du abrutschst, mache ich daraus einen Absturz.« Evas geheimer Zusatz zum Ehevertrag hätte lauten können: »Ich will dich als Partner, weil du männlich und stark bist und damit du mir die Sterne vom Himmel holst.« Der streng geheime Zusatz in ihrem Vertrag: »Ich neige zu Alleingängen. Ich werde dich oft überfahren, ich werde dich nicht fragen, ich werde bestimmen. Ich werde dich scheitern lassen, ohne daß du ein Wort zu sagen brauchst!«
Was ist aus diesen gegenläufigen, widersprüchlichen, unerfüllbaren Forderungen bei Adam und Eva geworden? Der Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies, ein mühevolles Leben nach dem Absturz. Wie viele Ehepaare beklagen, daß sie gerade das Gegenteil dessen erreicht haben, was sie wollten. Dabei haben sie es mit Hilfe der geheimen und der streng geheimen Zusätze zum Ehevertrag fast unausweichlich angesteuert. […]
Geheime Schwierigkeiten und Hoffnungen
Die Schwierigkeiten in der Partnerschaft liegen oft nicht am Partner, sondern tiefer, sozusagen in einer gemeinsamen Tiefe. Der Züricher Paartherapeut Jürg Willi hat in seinen Büchern über die Zweierbeziehung Partnerschaften als Kollusionen beschrieben (nach lat. colludere: spielen mit …, unter einer Decke stecken mit …), als ein geheimes Zusammenspiel zur Lösung eines gemeinsamen unbewußten Grundkonfliktes. Das bedeutet, daß beide Partner, beide Eheleute eine gemeinsame Schwierigkeit haben, die ihnen aber unbewußt ist. Bei Adam und Eva ging es um die gemeinsame Aufgabe, ganz Mensch in der Zweisamkeit zu werden. Bei der Kollusion, dem geheimen Zusammenspiel, übernimmt und lebt einer der Partner die aktive Rolle, der andere die passive. Das erklärt auch, warum der Volksmund meint: »Gleich und Gleich gesellt sich gern« und »Gegensätze ziehen sich an!« Gleich ist in der Partnerschaft der Grundkonflikt, gegensätzlich sind die gelebten Lösungsmöglichkeiten. Dabei kann – wie bei Adam und Eva – die vermeintlich schwache Frau insgeheim die Führung übernehmen, und der vermeintlich starke Mann ist vorwiegend das, was seine Frau aus ihm macht (Ich weiß, wovon ich rede!). Diese nach vorwärts oder rückwärts gerichteten Selbstheilungsversuche scheitern schließlich doch durch die Wiederkehr und die Dennochdurchsetzung des Verdrängten. Partnerschaftliche Schwierigkeiten können dann zu psychosomatischen Symptomen und Erkrankungen führen oder zu schwerwiegendem »krankhaften« Verhalten.
Partner sind bedarfsgerecht
Im Rahmen der Neurosenlehre hat man sogar von »neurotischer Partnerwahl« gesprochen. Dabei ist das vermeintlich Neurotische etwas zutiefst Menschliches. Jeder Partner sucht sich seine Ergänzung, sucht seine (bessere) Hälfte. Von der Neurosenlehre her gesehen bedeutet das, daß z. B. vorwiegend schizoid Strukturierte von vorwiegend depressiv Strukturierten angezogen werden und umgekehrt. Denn jeder hat das, was dem anderen fehlt. Der kühle zurückhaltende Schizoide sucht die Wärme und Gebefreudigkeit des Depressiven, der überanstrengte Depressive sucht die Abgrenzungsfähigkeit und Sicherheit des Schizoiden. Ähnlich ist es bei Partnerschaften zwischen vorwiegend zwanghaft Strukturierten und vorwiegend hysterisch Strukturierten. Der Zwanghafte soll in das Chaos des hysterischen Partners mehr Ordnung bringen, der hysterische Partner soll mehr Leben und Farbe in die im Ordnungssinn erstarrte Welt des Zwanghaften bringen. Andererseits ist die Partnerin, der Partner im narzißtischen Bereich (im Bereich der eigenen Großartigkeit) eine lebensnotwendige Aufwertung. Der von seiner Großartigkeit überzeugte Narzißt heiratet den ihn bewundernden Komplementär-Narzißten, also seine eigene Fan-Gemeinde, die die schmerzliche Lücke im Selbst füllt. Wenn dieser im Grunde gesichtslose Lückenfüller eigene Bedürfnisse entwickelt, wird er für den Narzißten unbrauchbar.
An diesen Beispielen wird deutlich, daß es in der Partnerschaft um gegenläufige Wünsche geht, deren gleichzeitige Erfüllung unmöglich ist. So gesehen ist jede Partnerschaft ein Selbsthilfeversuch. Gelingt er, dann nennt man das eine glückliche Ehe, gelingt er nicht, dann wird daraus ein manchmal behandlungsbedürftiger Partnerkonflikt. In der Behandlung dieser Partnerkonflikte wird dann oft deutlich, daß es gleichzeitig geheime und geheimste Zusätze zum Ehevertrag gibt, die sich gegenseitig ausschließen und zu allem Unglück auch noch unbewußt sind. Es kann also nicht darüber gesprochen werden, aber jeder besteht auf der Erfüllung seiner unbewußten und (damit) unerfüllbaren Forderungen.
Geheime und streng geheime Zusätze zum Ehevertrag
Die geheimen Forderungen, die geheimen Zusätze zum Ehevertrag haben etwa folgenden Wortlaut: »Ich will Dich als Partner oder Ehepartner, weil du … und damit du…«. Die streng geheimen Zusätze lauten dann: »Ich mache Dir die Erfüllung meiner Forderungen so schwer wie möglich oder sogar unmöglich, weil ich Angst vor dieser neuen Erfahrung habe.« Bei Adam könnte der geheime Zusatz in etwa so gelautet haben: »Ich will Dich als meine Partnerin, weil du ein Geschenk des Himmels bist und damit du mir im Paradies den Himmel auf Erden bereitest.« Der streng geheime Zusatz wäre dann gewesen: »Ich werde Dir dabei überhaupt nicht helfen. Wenn Du mich brauchst, bin ich nicht da. Wenn es schwierig wird, sage ich kein Wort. Wenn du abrutschst, mache ich daraus einen Absturz.« Evas geheimer Zusatz zum Ehevertrag hätte lauten können: »Ich will dich als Partner, weil du männlich und stark bist und damit du mir die Sterne vom Himmel holst.« Der streng geheime Zusatz in ihrem Vertrag: »Ich neige zu Alleingängen. Ich werde dich oft überfahren, ich werde dich nicht fragen, ich werde bestimmen. Ich werde dich scheitern lassen, ohne daß du ein Wort zu sagen brauchst!«
Was ist aus diesen gegenläufigen, widersprüchlichen, unerfüllbaren Forderungen bei Adam und Eva geworden? Der Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies, ein mühevolles Leben nach dem Absturz. Wie viele Ehepaare beklagen, daß sie gerade das Gegenteil dessen erreicht haben, was sie wollten. Dabei haben sie es mit Hilfe der geheimen und der streng geheimen Zusätze zum Ehevertrag fast unausweichlich angesteuert. […]
aus einem Vortrag von Dr. med. Wolfgang Scherf, gehalten auf dem 54. Psychotherapie-Seminar in Freudenstadt, 1997
(auf seiner Seite kann man sich auch den ganzen Text ansehen)
(auf seiner Seite kann man sich auch den ganzen Text ansehen)